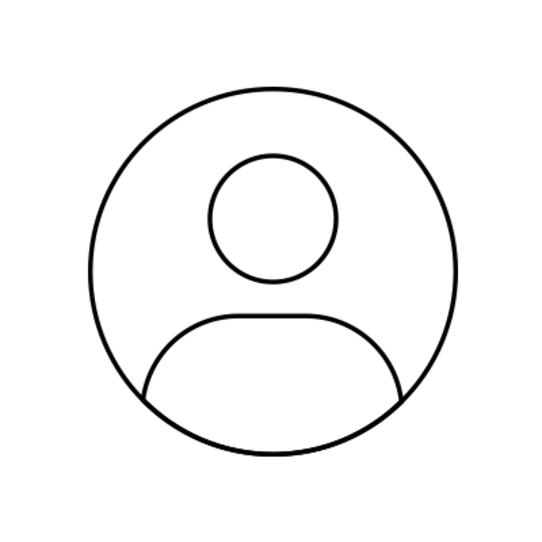Für die Funktionsfähigkeit der Bundeswasserstraßen sind Wasserbauwerke wie Spundwände, Schleusen oder Wehre unerlässlich. Korrosionsschäden an wasserbaulichen Anlagen verursachen hohe wirtschaftliche Kosten und gefährden die Stand- und Betriebssicherheit der Bauwerke. Schätzungen zufolge sind 20 bis 50 % aller Korrosionsschäden an Metallen und Baustoffen mikrobiell beeinflusst. Sie werden durch Stoffwechselaktivitäten von Mikroorganismen ausgelöst, sind aber auch abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, pH-Wert, dem Baustoff oder der Hinterfüllung. Dabei entstehen charakteristische „Korrosionspusteln“, die als Aufwölbungen erkennbar sind.
Veranlassung
Trotz des bekannten Einflusses mikrobieller Prozesse auf die Langlebigkeit von Wasserbauwerken ist der Zusammenhang zwischen mikrobiellem Bewuchs und Korrosion der eingesetzten Materialien unklar und wird daher bei der Planung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen kaum berücksichtigt. Auch die Mechanismen und Faktoren, die das Auftreten mikrobiell-induzierter Korrosion begünstigen, sind nur unzureichend erforscht. Diese Wissenslücken sollen in Kooperation mit der Universität Koblenz-Landau und der Bundesanstalt für Wasserbau geschlossen werden. Die Arbeiten der BfG konzentrieren sich insbesondere auf die gezielte Anwendung moderner molekularbiologischer Methoden (Genomics, Transcriptomics, Proteomics) für eine umfassende Analyse mikrobieller Gemeinschaften und auf die Untersuchung der Umweltbedingungen, unter denen diese Mikroorganismen aktiv sind. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen neue Möglichkeiten aufzeigen, wie mikrobielle Korrosion frühzeitig erkannt, die Lebensdauer und Sicherheit von Wasserbauwerken erhöht und Unterhaltungskosten gesenkt werden können.
Ziele
- Untersuchung des komplexen Ursache-Wirkungsgeflechts zwischen mikrobiell induzierter Korrosion, gewässerchemischen Eigenschaften und mikrobieller Diversität
- Minimierung und frühzeitige Erkennung mikrobiell induzierter Korrosion zur Gewährleistung eines nachhaltigen Instandsetzungsmanagements wasserbaulicher Anlagen
- Unterstützung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung bei der Planung von Wasserbauwerken
Ergebnisse
- Durch die Mikrosensormessungen konnte gezeigt werden, dass sich in den Korrosionspusteln besondere Bedingungen (niedriger pH, anoxische Zonen und niedriges Redoxpotenzial) einstellen, welche stark von den Umgebungsbedingungen abweichen.
- Eine entsprechend komplexe und auf die vorherrschenden Gradienten angepasste mikrobielle Lebensgemeinschaft konnte mittels NGS-Sequenzierung nachgewiesen werden (zum Beispiel Eisenreduzierer (Geothrix), Sulfatreduzierer (Desulfovibrio), Eisenoxidierer (Gallionella)).
- Korrosionsraten wurden durch das Ausbringen und Auswiegen von Stahlcoupons an sechs Standorten quantifiziert.
- Einige der Mikroorganismen, die in den Rosttuberkeln im Freiland nachgewiesen wurden, konnten im Labor angereichert werden, um Schlüsselorganismen für MIC (microbial induced corrosion) zu identifizieren.
- Bei Versuchen mit Reinkulturen verschiedenster Sulfatreduzierer konnten die unterschiedlichen Korrosionsmechanismen aufgezeigt werden.
Ausblick auf die nächsten Jahre
- Mithilfe von Proteomics sollen die Schlüsselproteine bei den verschiedenen Korrosionsmechanismen identifiziert werden.
- Die Korrosionsraten sollen mit den jeweils vorherrschenden Umweltbedingungen korreliert werden, um eventuelle Risikofaktoren zu erkennen.
- Beim Vergleich der Korrosionspusteln aller Standorte soll die für die Korrosion typische Lebensgemeinschaft („Core Community“) identifiziert werden.
- Dadurch können potenzielle biologische MIC-Indikatoren abgeleitet werden.
- Das methodische Repertoire der BfG hinsichtlich mikrobiologischer und molekularbiologischer Kompetenzen wird ausgebaut.
Projektpartner
- Bundesanstalt für Wasserbau
- Universität Koblenz-Landau, Institut für Integrierte Naturwissenschaften
- Eberhard-Karls-Universität Tübingen